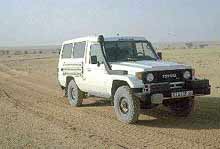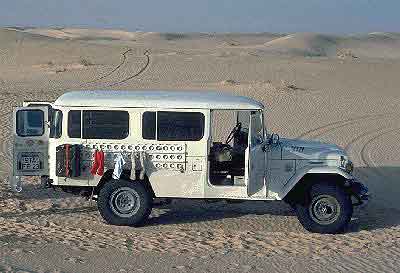|
War es am Anfang nur der Wunsch, ohne Rücksicht auf rationale
Entscheidungskriterien, eines jener urigen Geländefahrzeuge von der Art
eines Jeeps oder Land Rovers zu besitzen und mit diesem die Wüste zu
erkunden, so kristallisierten sich nach und nach jene Grundforderungen heraus,
deren Erfüllung im Hinblick auf ein sicheres und möglichst bequemes
Reisen in der Sahara und Afrika unabdingbar sind:
-
Das Reisefahrzeug muß von Haus aus konstruktiv auf den geplanten Einsatzzweck ausgelegt sein
-
Das Reisefahrzeug muß robust, zuverlässig und anspruchslos sein
-
Das Fahrzeug muß über einen drehmoment-starken Dieselmotor
verfügen, der auch schlechte Treibstoffqualitäten verträgt,
über permanenten oder während der Fahrt zuschaltbaren
Vierradantrieb, über ein Untersetzungsgetriebe und möglichst
über Differentialsperren in Vorder- und Hinterachse
-
Schraubenfedern an starrer Vorder- und Hinterachse zur Erhöhung der
Bodenfreiheit
-
Es muß mit möglichst wenig Spezialwerkzeug auch unter
primitivsten Umständen leicht zu warten und zu reparieren sein
-
Vor Abreise muß das Fahrzeug in perfektem Zustand sein, das gilt
speziell für Reifen und Batterie
-
Unser Reisefahrzeug muß eine ebene, ausreichend große
Liegefläche (ca. 1,50 x 2,00m) aufweisen mit genügender
Kopffreiheit
-
Das Fahrzeug muß vom Raumangebot und vom zulässigen
Gesamtgewicht her in der Lage sein, Vorräte aller Art (Treibstoff,
Wasser, Lebensmittel, Ersatzteile, bzw.Verbrauchsmaterialien,
Campingutensilien, Medikamente und Kleidung) für eine 6-wöchige
Tour abseits aller Versorgungsmöglichkeiten aufzunehmen
-
Es muß konstruktiv geeignet sein, für den Fall mehrmonatiger
Reisen, schwere Dachlasten auf einem stabilen Dachträger sicher zu
transportieren
-
Die Mitnahme zweier kompletter Reserveräder muß möglich
sein
|
Diesem Forderungskatalog entspricht am besten der Toyota LandCruiser HZJ75
('Troop Carrier'), bzw. das Nachfolgemodell HZJ78.
Es ist daher nicht verwunderlich, daß er das mit Abstand beliebteste
Fahrzeug bei Sahara-Fahrern ist und auch von professionellen Nutzern in der
Dritten Welt, wie Hilfsorganisationen, Baufirmen und Prospektoren, geschätzt
wird.
zum Seitenanfang
Nachfolgend eine Bewertung der von uns gefahrenen geländegängigen
Reisefahrzeuge:
(3 Reisen 1975-1978)

Unser erstes Geländefahrzeug. Es hat uns auf drei Reisen nie im Stich
gelassen, sieht man von einem in einer Panzerzündspule abgebrochenen
und steckengebliebenen Zündschlüssel ab, von unzähligen
gebrochenen Federn, einer defekten Wasserpumpe und einem defekten Getriebe.
Immerhin haben wir es stets aus eigener Kraft nach Hause geschafft.
Erst dort gab es dann die großen, kostspieligen Probleme:
Motor, Differential, Steckachsen, Simmeringe. Kurz, es gab kein Bauteil,
das in den 3 Jahren, die wir den Landy besaßen, nicht repariert werden
mußte. Nach einer Generalüberholung wurde es dann guten Gewissens
verkauft. Wir waren viele Sorgen los, aber auch ebensoviel Geld.
Was wir mit dem Kauf des Landys nicht ahnen konnten war, daß dadurch unser
gesamtes Leben bis zum heutigen Tag auf die Wüste hin und auf Reisen
in die Sahara, nach Afrika, Arabien und Zentralasien ausgerichtet wurde.
Vom Konzept her war der 88er für größere Touren kaum geeignet.
Er konnte zwar 12 Benzinkanister schleppen, dazu noch 80 Liter Wasser,
Essensvorräte, Ersatzteile und Campingsachen, und, dank einer
ausgeklügelten Mechanik, gab es sogar eine durchgehende, ausreichend
grosse Liegefläche von der Hecktüre bis zur Windschutzscheibe.
Doch unter all der Last mußten die schwächlichen Federn einfach
zusammenbrechen. Zum Glück bekam man sogar neue Federblätter
überall in Afrika! Auf einen langen 109er umzusteigen kam uns nicht
in den Sinn, da der kleine 88er schon brutal genug zu fahren war und wir
ein kleineres Fahrzeug benötigten, um allabendlich eine Parklücke
im Münchner Großstadtdschungel finden zu können.
zum Seitenanfang
(1 Reise 1979/1980)

Eigentlich sollte unser zweites Geländefahrzeug ein Dieselauto werden.
Außer Land Rover mit schwächlichem Diesel wurde am Markt nichts angeboten.
So entschlossen wir uns für einen Toyota mit bärenstarkem 6-Zylinder
Benzinmotor und bulligem Aussehen.
Wir wunderten uns über den filigranen
Getriebeblock, auch darüber, daß Steckachsenbrüche bei Toyota
absolut unbekannt waren und daß wir auch bei Regen keine Tropfen abbekamen.
Die vier Türen waren für unsere Zwecke kaum von Vorteil, sie
komplizierten eher den Einbau der Reiseeinbauten. Ein Dachgepäckträger
mußte her. Dieser wurde besonders stabil konstruiert, was zur Folge hatte,
daß er den natürlichen Verwindungen des Karosseriekörpers
bei schweren Pistenfahrten nicht folgen konnte und die Dachrinne allmählich
über die halbe Fahrzeuglänge in Stücke riss...
Ein selbstgebautes
Bullgard wurde schon hinter Tamanrasset wieder abgebaut, da die durch die
Wellblechpisten verursachten und durch das Bullgard übertragenen
Vibrationen den Kühler zu beschädigen drohten. Als besondere
Überraschung an diesem Fahrzeugtyp stellte sich heraus, daß
der Schlauch der Tankentlüftung nicht weit genug nach oben geführt
wurde, was zur Folge hatte, daß sich bei vollem Tank und Schräglage
des Fahrzeugs ein Benzinstrahl direkt auf den heißen Auspuff ergoß.
Ein anderes Problem war die Dampfblasenbildung in den Treibstoffleitungen
im Motorraum, was sich bei sommerlichem Großstadtverkehr sehr
ungünstig auswirkte.
Im Winter gab es dafür andere Probleme:
Die standardmäßige Serienbereifung (Dunlop Road Trak Major LT, 7.50x16)
hatte wahrhaft kriminelle Fahreigenschaften. Die Diagonalreifen benötigten
nicht nur 10 km, bis sie einigermaßen rund liefen, Nässeverhalten und
Bremseigenschaften waren einfach katastrophal! Die Katastrophe erwischte
dieses Auto denn auch, als es bei Schneeglätte fast in den Starnberger See
schlitterte, was nur dadurch verhindert wurde, daß es vorher an einem
Baum zerschellte. Damit war es uns unfreiwillig gelungen, das Problem des
enormen Benzinverbrauches zu lösen.
In der Wüste aber war dieses
Auto unschlagbar: Da staunten die armen Algerier nicht schlecht, als wir
vom Westen her den Erg Admer in einem Zug in der Diretissima
hinauffuhren, während sie sich zuvor mit ihren elenden Land Rovern in
Serpentinen (!) hinaufquälten.
zum Seitenanfang
(4 Reisen 1981-1985)
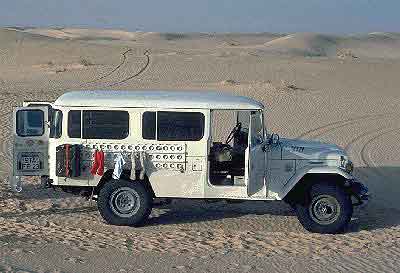
Nach vier Touren ließ uns die Sahara nicht mehr los. Ein neues Auto
war fällig. Der BJ45 sah zwar ziemlich skurril aus mit seiner
Überlänge, er kam unseren Vorstellungen von einem idealen
Reisefahrzeug aber schon sehr nahe: sparsamer Dieselmotor, großes,
gut ausbaubares Inneres, keine Notwendigkeit eines Dachgepäckträgers
mehr, auch bei langen Reisen, und dennoch extremer Aktionsradius. Das Auto
war zweckmäßig, spartanisch und hatte - wie ein Land Rover - Charakter.
Es war robust und zuverlässig, sieht man von den üblichen
Federbrüchen, bedingt durch Überladung und fahrerische Unachtsamkeiten,
einmal ab.
Als anfällig erwies sich der 3B-Motor. Überhitzungen
bei langen Weichsandstrecken führten zu Problemen mit dem Zylinderkopf:
die Zylinderkopfdichtung wies nicht die übliche Toyota-Qualität
auf, Risse in den Einspritzkammern hatten kostspielige Reparaturen zur
Folge. Wegen eines defekten (mechanischen) Reglers wurden die beiden Batterien
überladen und gaben schlagartig zur gleichen Zeit ihren Geist auf. An ein
Anlassen des Motors war dann nicht mehr zu denken... Vor Freunden konnte ich
später nachweisen, daß es sehr wohl möglich ist, den
3B-Motor über ein freies Hinterrad (das andere bleibt am Boden) bei
eingelegtem Gang per Abschleppgurt anzuwerfen. Wichtig dabei: die Einspritzpumpe
muß auf Stellung 'Start' stehen!
Mit diesem Fahrzeug machten wir die
schönsten Touren, deren Höhepunkt die Gilf Kebir-Fahrt 1983/84
war. Leider hatte der BJ45 einen ganz großen Fehler, der mir erst
auffiel, als es schon zu spät war: er rostete und rostete. Auslöser
waren die Schweißpunkte am Rande der Radkästen. Auch das
Blechmaterial muß von einer ganz besonders miesen Qualität
gewesen sein. So mußte ich mich tränenden Auges von diesem
liebgewonnenen Auto trennen und es verkaufen.
zum Seitenanfang
(4 Reisen 1985-1989)

Liest man heute die ersten Rezensionen, die über dieses Fahrzeug
erschienen (Tours 3/85 und, ausführlicher,
Tours 4/85), so wird klar,
daß man dem nun stark begehrten 75er, bzw. 78er, bei seinem Erscheinen
1985 noch ziemlich skeptisch gegenüber stand, hatte man ja den
bewährten BJ45 gerade erst schätzen gelernt.
Mein BJ75 war das erste
in Deutschland zugelassene Fahrzeug dieses Typs und viele hunderte sollten im Laufe der Jahre
begeisterte Besitzer finden. Der Grund: dieses Fahrzeug erfüllt nun
schon fast in idealer Weise die oben geschilderten Anforderungen an ein
Wüsten- und Reisefahrzeug. Dabei ist klar zu sagen, daß es sich
beim BJ75 eben nicht um einen Dünenhopper handelt, dafür gibt es viel
geeignetere Fahrzeuge.
Nein, es handelt sich bei diesem Auto um ein nahezu
perfektes Fernreisefahrzeug, das vorzugsweise in der Sahara und Afrika zum
Einsatz gelangt. Im Sand tut es sich etwas schwer, was in erster Linie durch
die riesigen, tief nach unten hängenden Blattfederpakete und die im Sand
damit verbundene Bodenankerwirkung bedingt ist. Mit großen Reifen und
normaler Beladung ist der BJ75 dennoch, trotz relativ bescheidenem 90-PS-Saugdieselmotor,
jeder Herausforderung, auch in den Dünen, gewachsen. Natürlich
fühlt er sich auf Marathonstrecken wohler.
Er ist extrem zuverlässig und robust, nur hintere Federlagen sollte man als
Ersatzteil immer dabeihaben. Mit höherem Alter gibt es Undichtheiten an den
Differentialsimmeringen. Bei weitem unangenehmer ist da schon eine fast nicht
in den Griff zu bekommende Undichtheit des Getriebeblocks sowie eine
Undichheit zwischen Haupt- und Reduziergetriebe. Für letzteres Problem
haben engagierte Toyota-Ausrüster aber eine einfache Lösung parat.
Mit diesem BJ75 haben wir vier ausgedehnte Reisen durch die entlegensten Gebiete
der Sahara unternommen, nur einmal in Begleitung eines Freundes. Nie gab es
irgendeine technische Panne oder gar ein Problem. Und es hätten noch viele
Reisen mehr werden sollen. Doch leider verglühte dieses Auto in der Tiefgarage
unserer Wohnanlage, als ein anderes Fahrzeug nächtens in Brand
geriet. So mußten wir uns, nach sorgfältiger Restauration, auch
von diesem treuen Auto vorzeitig trennen.
zum Seitenanfang
(7 Reisen 1989-1999)

Nach dem Feuer in der Tiefgarage mußte eiligst ein neuer BJ75
beschafft werden. Erstens, weil wir die dort verbliebene Einrichtung
unbeschädigt retten und in einem neuen Fahrzeug gleichen Typs wiederverwenden
konnten und zweitens, weil ohnehin kein anderes Fahrzeug in Frage kommen
konnte.
In Tag- und Nachtschichten wurde, neben der anspruchsvollen
Berufstätigkeit, der neue, pünktlich gelieferte Toyota
ausgerüstet und für die kurz bevorstehende Tour hergerichtet.
Dazu gehörten auch angebliche Superfedern aus Australien, nicht die heute
üblichen OME, sondern 'Ultimate Suspension'. Der seit 1985 betriebene
SATNAV-Satelliten-Navigationsempfänger wurde ausrangiert und ein Garmin
GPS 120 trat an seine Stelle. Die VDO-Fluxgate-Anlage wurde jedoch als
Stand-by übernommen. Damit ähnelte dieser zweite BJ75 seinem
älteren Bruder fast wie ein Ei dem anderen.
Die erste Reise mit diesem
LandCruiser verlief nicht sehr rühmlich, verständlich, war es
doch auch unsere 13. Saharafahrt. Statt über den Uwainat El Fasher
im Sudan zu erreichen, landeten wir nach einigen Abenteuern in der Rebiana
Sandsee schließlich am Weihnachtsabend 1989 aus unerfindlichen
Gründen im Geheimdienstgefängnis von Sebha. Dafür waren die
folgenden 6 Reisen in alle denkbaren Winkel der geliebten Sahara umso
erfolgreicher.
Nie ließ uns der BJ75 im Stich (Federbrüche
waren an der Tagesordnung, damit wurden wir schon spielend fertig). Nach
fast 90.000 Sahara-Kilometern und 10 Jahren treuer Dienste wurde er
schließlich verkauft, technisch und optisch in allerbestem Zustand.
zum Seitenanfang
(7 Reisen 1999-2005)

Im August 99 war es dann soweit: der neue LandCruiser HZJ75 stand vor der
Türe. Einfach phantastisch der gewaltige Saugdiesel, das Auto war noch
bequemer zu fahren dank der erstmals genossenen präzisen Servo-Lenkung.
Nur, es hatte den Anschein, als sei die Verarbeitungsqualität etwas
zurückgegangen. Mit Eifer ging es an den Um- und Ausbau des Fahrzeugs.
Wir wollten die Chance nutzen, es ganz unseren Reisebedürfnissen
entsprechend maßzuschneidern.
Und das ist daraus geworden:
Nachfolgend die Ausbaukonfiguration des HZJ75, wie sie sich in 28 Jahren
Sahara-Reisen für unsere Bedürfnisse als optimal herauskristalliert hat:
-
MOTOR
- Safari-Snorkel, 2 Optima red Batterien (mit Spezial-Ladegerät!),
Batteriehauptschalter
- bewußt nicht eingebaut wurden: Turbo-Kit, Fächerkrümmer
und verkürzter Auspuff in Edelstahl,
zweites Treibstoffilter, Trabold-Filter
-
FAHRWERK
- OME schwer, einschließlich Lenkungsdämpfer,
Gasdruckstoßdämpfer, abschmierbare Federschäkel
und Rahmenbolzen
-
RÄDER
- Straßenbetrieb (Winter und Sommer): BFG AT,
235/85R16, schauchlos, auf 6J16 Sternfelgen
- kürzere Saharareisen (6 Wochen): Michelin XS,
7.50R16, mit Schlauch und Wulstband, auf original
16x5.50F SDC Sprengringfelge
- längere Reisen (Sahara, Afrika, Arabien, Zentralasien):
Michelin XZL, 8.25R16, mit Schlauch und Wulstband, auf original 16x5.50F SDC
Sprengringfelge
-
KAROSSERIE (außen)
- seitliche Fensterflächen verschlossen und isoliert
- verlängerte Originalstoßstange vorne mit
Halterungen für 2 Stück 20l-Kanister und Alu-Sandschaufel
- Fernscheinwerfer
- Rückleuchten hinten hochgesetzt
- Sandblechhalterungen an Seitenwänden
- Reserveradträger an rechter Hecktüre
(mit verstärkten Halterungen) und Vibrationsstopper
-
KAROSSERIE (innen)
- Laderaum mit Alu-Riffelblech ausgekleidet
- halbhohe Trennwand zwischen Sitzen und Laderaum
- Staukisten rechts und links entlang der Seitenwände
- zwischen Staukisten drei Liegeflächenelemente (Liegefläche
ca. 145x210 cm)
- auf Ladefläche zwischen Staukisten 2 Stück VA-Dieseltanks
(zu je 250 l), befestigt mit Spannbändern, Innenbefüllung.
Entnahme wahlweise aus Haupttank, Reservetank 1 oder Reservetank 2
- Sportsitze von
Renato
- Ablagekonsole zwischen den Sitzen von
www.consoles.com
mit integriertem Notsitz
-
AUSRÜSTUNG
- ARB-Dachgepäckträger
- Garmin 120 GPS mit Hochgewinn-Antenne
- Becker Mexico Prof 2430 KW/UKW-Radio
- Stabo 40-Kanal FM CB-Funkgerät mit DV 27-Fuß am Dach
- Leseleuchte
- Digitaluhr
- elektr. Thermometer (innen/außen)
- Motorölthermomter
- Amperemeter
- 24/12V DC Wandler (2 Stück)
|
Mit diesem Fahrzeug hatten wir fast 170.000 km zurückgelegt,
davon 150.000 km auf sieben Reisen durch die
Sahara, durch Afrika, Arabien und Zentralasien. Während dieser Zeit gab es keine
einzige Panne, von (fast unvermeidlichen) Federbrüchen einmal abgesehen!
Als besonders ungünstig haben sich wieder einmal die beim HZJ75 weit
nach unten hängenden hinteren Blattfederpakete herausgestellt, die die
Bodenfreiheit drastisch verringern, wobei deren Ankerwirkung in tiefem Sand
und sibirischem Schlamm sehr schnell zum Festfahren führt. Das OME-Fahrwerk
erwies sich als hervorragende Wahl! Es ist extrem robust und doch geschmeidig.
Der Fahrkomfort ist, selbst bei leerem Auto, in dieser Fahrzeugklasse einfach Spitze!
Erstaunlicherweise war eine gravierende Leistungseinbuße
bei Fahrten in Höhen bis 4000 m kaum festzustellen. Etliche
hochgelegene Pässe im Pamir und Karakorum (über 4700m) konnten
vollbeladen gerade noch im zweiten Gang genommen werden.
Unerklärliche, ernstere Probleme gab es jedoch immer wieder durch
unregelmäßig auftretendes, also nicht reproduzierbares,
Motor-Ruckeln bei hohen Drehzahlen wegen gestörter Treibstoffzufuhr.
Steilere Bergstrecken konnten dann fast nicht mehr bewältigt werden!
Eine Klärung der Ursache ist abschließend noch nicht gelungen.
Zweifellos liegt der Fehler nicht an einem verstopften Treibstoffilter. Vielmehr
ist zu vermuten, daß es sich um im Treibstoff-Umschalthahn
(Haupttank und 2 Reservetanks!) hängengebliebene Luftblasen handeln
könnte. Ausblasen der Treibstoffleitung vom Filter zu den Tanks brachte
nämlich eine schlagartige, aber keine nachhaltige Verbesserung. Merkwürdig
auch, dass der Ruckel-Effekt oft nach kurzem Stillstand des Fahrzeugs auftrat.
Dies erinnerte uns sehr an die beim FJ55 im sommerlichen Stadtverkehr regelmässig
auftretende Dampfblasenbildung in der Treibstoffzufuhr.
Zu unserem grossen Leid verloren wir dieses Fahrzeug bei einem
Überschlag
auf vereisten Spurrillen in der kasachischen Steppe bei Yirghis im November 2005.
zum Seitenanfang
(10 mehrmonatige Reisen seit 2007)
So traumatisch das tragische Ereignis in Yirghis 2005 auch war, die darauf folgenden
Monate zu Hause waren ohne Toyota und die Möglichkeit, wieder im gewohnten
Stile zu verreisen, nicht leicht zu ertragen. Um unser Leben wieder in alte Bahnen zu
lenken, entschlossen wir uns erneut zum Kauf eines LandCruisers.
Mit freundlicher Genehmigung von Handelskontor Automobile, Wartenberg
Nach kurzer Suche im Internet erstanden wir ein
Fahrzeug, dessen Äusserem man die 64.000 km nicht ansah. Da die Probefahrt auch zu unserer
vollen Zufriedenheit verlief, war klar, dass der Wagen gekauft wurde. Diese Entscheidung
erwies sich als durchaus richtig, wie sich schon auf der ersten Reise durch Westafrika zeigte.
Doch dazu waren noch einige Modifikationen erforderlich gewesen, für die wir
Tom's Fahrzeugtechnik
beauftragten.
Nach dem Kauf wurde als erstes eine Generalreinigung des Fahrzeuginneren in Angriff genommen. Bei
dieser Gelegenheit wurden gleich die beiden hinteren Längssitzbänke entfernt. Die
Anhängerkupplung wurde abgebaut und das primitive Radio durch ein
Kurzwellenradio vom Typ Becker Mexico 2340 ersetzt, das als fabrikneues Gerät
bei ebay billigst erworben wurde. Die Fulda-Reifen wurden schnellstens
entsorgt, dafür General Grabber AT2 montiert (285/75R16 auf 8-Zoll Original Toyota-Felgen).
Damit war das Fahrzeug in einem Zustand, mit dem man vorerst leben konnte.
Da bekanntlich die Verteilergetriebewelle in HZJ78 des Baujahres 2001 wegen eines
Konstruktionsfehlers zu plötzlichem Bruch neigt, erschien es unumgänglich,
diese vorsorglich durch die verbesserte Version zu ersetzen. Mit dieser Arbeit
wurde Michael Neuderth von Desert-Tec
betraut. Michi erwies sich als absoluter Profi, der mit grosser Erfahrung und Systematik an die
Arbeit ging. Bei diesem Werkstattbesuch fand sich noch Zeit, eine Motoroptimierung
hinsichtlich Drehmomentverlauf durchzuführen. Das von vielen HZJ-Eignern beklagte
'Drehmomentloch' bei mittleren Drehzahlen ist bei meinem HZJ78 glücklicherweise
nicht festzustellen, ganz im Gegensatz zum Vorgängerfahrzeug HZJ75 mit dem
gleichen 1HZ-Motor. Dabei bewegt sich der Verbrauch in vernünftigen Grenzen: Auf der 3-monatigen Reise
im Frühjahr 2007 lag dieser bei 11.3 Liter auf 100 km, wobei auf weiten Strecken
9.5 Liter erreicht werden konnten, ohne besondere Maßnahmen. Auf sandigen und
steinigen Pisten lag der Verbrauch erwartungsgemäss bei etwa 16 Litern auf 100 km.
Um aus dem HZJ78 ein für unsere Bedürfnisse optimales Reisefahrzeug zu machen,
wurden vor der ersten Tour folgende Um- und Einbauten vorgenommen:
- 2 orthopädische Schalensitze,
Renato,
Typ 101 mit integrierter Kopflehne
- Mittelkonsole mit Notsitz
- Garmin GPS 152 mit interner Antenne
- Webasto Thermo Top Z/C 5.2 kW Wasserheizgerät (Standheizung)
- 2 BOSCH Starktonhörner
- IPF Fernscheinwerfer
- 2 Optima Batterien, rot
- Original Toyota Windenstoßstange
- Mückenschutzgitter zwischen Kühlergrill und Kühler
- Seitenwandverkleidungen in passiviertem Alu-Riffelblech
(Carmaeleon)
- diverse Karosseriearbeiten wie Verblechung der Seitenfenster, Einbau von seitlichen
Staukisten (passiviertes Alu-Riffelblech) und eine dazwischen befindliche Liegefläche
aus 19 mm Siebdruck-Platten.
- ein 200 Liter Dieseltank zur Montage im Innenraum, Material: extrudiertes Polyäthylen,
10mm stark, Hersteller: amalric plastic,
geliefert von Carmaeleon
- verstärkte, pistenfeste Reserveradhalterung mit Vibrationsstopper
- 4 Sandblechhalterungen zur seitlichen Montage der Bleche
- 5 Stück BFG MT 255/85R16 auf Original Toyota Felge 6.50x16J (42601-60610)
 |
|
 |

|
|
Ausbau wie bei den bisherigen 75ern, also mit seitlichen Längskisten in Alu.
Hinter den Sitzen zwischen den Seitenkisten das Abteil mit dem 200 Liter Tank.
Der Tank wird nach Umklappen der Sitzlehne von innen befüllt. Im Stauraum ganz vorne,
anschliessend an das Tankabteil, ist Platz für vier Weithals-Wasserkanister mit je 25 l Inhalt.
Zwischen den Seitenkisten 4 leicht abnehmbare 19 mm Siebdruckplatten (Liegefläche 2.0x1.4m).
Im Stauraum werden RUKO-Kisten in verschiedenen Größen optimal untergebracht.
|
Was hat sich also zum Vorgängerfahrzeug HZJ75 geändert?
Reservetank
Ganz entscheidend
ist nun das Fehlen eines zweiten Reservetanks. Der HZJ75 war seinerzeit ja konzipiert worden
für etwa 6-wöchige extreme Saharatouren, die einen Aktionsradius von 3000 km oder mehr
verlangten. Daher die Gesamtkapazität von 620 Litern, einschliesslich der beiden
Reservekanister auf der Windenstoßstange. Mit den vor einigen Jahren eingetretenen
drastischen Einschränkungen im freien Reisen in fast der gesamten Sahararegion, haben
sich auch unsere Reiseprojekte wesentlich gewandelt. Das heißt, wir können uns
nunmehr mit einem einzigen Reservetank mit 200 Litern begnügen. Dieser leistet
aber auch in Ländern mit ausreichendem Tankstellennetz gute Dienste, etwa dann, wenn
in dem einen Land die Dieselpreise sehr hoch sind oder die Qualität sehr schlecht ist
und man die Möglichkeit hat, im Nachbarland günstiger zu tanken.
Schnorchel
Auffallend auch der nicht vorhandene Ansaugstutzen. Zum ersten Mal (seit unseren 75ern)
verzichteten wir auf die Montage eines außenliegenden Luftansaugstutzens. Die Staubanscheidung
funktioniert dank des im Original-Filtergehäuses eingebauten Zyklons ohnehin bestens.
Und die Verschmutzung des Filterelementes erfolgt hauptsächlich durch rußige
LKW-Dieselabgase, gegen die kein Schnorchel hilft. Sehr zu empfehlen ist der Schnorchel eigentlich nur dann,
wenn metertiefe Wasserdurchfahrten gemeistert werden müssen. Mit dem Schnorchel könnte so
verhindert werden, dass Wasser in das Luftfiltergehäuse und von dort weiter in den
Verbrennungsraum eindringt, wo es kapitale Schäden verursachen würde.
Fahrwerk
Nach der Westafrika-Tour haben wir uns für den Einbau eines neuen Fahrwerks entschieden:
Nach Auswertung von vier Angeboten wurde das Originalfahrwerk ausgemustert und durch ein
OME-Fahrwerk ersetzt. Ausschlaggebend hierfür war, dass auf der Mauretanien/Mali-Tour 2007
die Federn durch fahrerische Unachtsamkeit einen wahrhaft fürchterlichen Schlag abbekommen
hatten.
Beim Einbau des OME-Fahrwerks zeigte sich, dass das original
Toyota-Fahrwerk (nach über 80.000 km) äusserlich keinerlei Schadspuren aufwies, auch
die gut dimensionierten Stossdämpfer waren noch voll funktionsfähig. Dennoch
wurden sie durch die bewährten OME-Nitrocharger ersetzt. Die Blattfedern
für die Hinterachse des HZJ78 sind etwa 20 cm länger als jene des HZJ75. Von
der Qualität her scheint OME einen grossen Sprung nach vorne getan zu haben, zumindest
was die Oberfläche der Federblätter betrifft. Die im Bereich der Achse früher
vorhandenen Abflachungen der Federn sind nun verschwunden, was die Verwendung von
Ersatzfederblättern erleichtert.
Das montierte OME-Fahrwerk brachte eine beachtliche Höherlegung von 8 Zentimeter,
was dem Fahrzeug durchaus gut zu Gesicht steht, was allerdings auch eine vorsichtigere
Fahrweise verlangt. Das ursprüngliche Bremsverhalten der Hinterachse wurde durch
eine entsprechende Höherlegung des Bremskraftregelventils wieder hergestellt. Es erwies
sich als unnötig, einen 'Caster-Kit' zu montieren.
Dachträger
Bei mehrmonatigen Reisen, wie wir sie seit 1998 unternommen
haben, war ein stabiler Dachgepäckträger unumgänglich. Sehr bewährt
hat sich bei uns der Träger von ARB. Er ist extrem stabil und schwer, verleitet
aber zur Überladung. Das HZJ-Dach verkraftet dies nicht so ohne weiteres. Es kann
durchaus zu Rissen in der A-Säule kommen! Sehr zu bezweifeln ist, ob der fast doppelte
Preis des stark propagierten African-Outback-Dachträgers das Gebotene wert ist. Als
Alternative böte sich der hier neu auf dem Markt befindliche FRONTRUNNER-Alu-Dachträger
an, dessen Preis allerdings die 1000-EURO-Marke erreicht. Im Hinblick auf bevorstehende
mehrmonatige Reisen und auf Grund der bisher positiven Erfahrungen entschlossen wir
uns wiederum zum Kauf eines ARB-Trägers. Im
BUSCHTAXI-Marktplatz wurde ein
solcher sehr preisgünstig und dazu noch wie neu angeboten.
Bereifung
Noch ein Wort zur Wahl der Reifen: Am alten HZJ75 wurden folgende Reifen eingesetzt:
im normalen Straßenbetrieb BFG AT 235/85R16 auf 6J16 Sternfelgen, im
Wüsteneinsatz Michelin XS 7.50R16 mit Schlauch und Wulstband auf original Toyota
16x5.50 SDC Sprengringfelgen und zuletzt, auf den mehrmonatigen Touren,
Michelin XZL 8.15R16 mit Schlauch und Wulstband auf Sprengringfelgen.
Nachdem der Vorbesitzer des HZJ78 das Reifenformat 285/75R16 eingetragen bekam,
blieb ich dabei. Es gab keinen Grund, wieder auf 235/85R16 umzusteigen, auch keinen
preislichen. Der 285/75R16 passt einfach besser zum HZJ. Er ist deutlich breiter und
etwas höher als der 235er. Handling und Komfort der General Grabber AT2 285/75R16 sind
merklich besser als jene der BFG AT in 235/85R16, das Abrollgeräusch ist jedoch
deutlich hörbarer.
Da ausgesprochene Wüstentouren nicht mehr in Frage kommen, habe ich vom Kauf
spezieller Sandreifen abgesehen. Der XS in 7.50R16 ist für ein Schwergewicht
wie dem HZJ ohnehin zu wenig tragfähig, in der Größe 9.00R16 zwar
optisch vorteilhaft, vom Preis und Gewicht her (reduzierte Bremswirkung!) sowie bei
unveränderter Differentialübersetzung indiskutabel.
Als Kandidaten für lange Touren in unterschiedlichsten Geländeformen kamen beim
neuen HZJ nur zwei Reifentypen in Frage: der altbewährte Michelin XZL im
Format 8.25R16 (mit oder ohne Schlauch zu fahren) und der Mud Terrain von BFG im Format
255/85R16 (nur schlauchlos!). Der XZL ist ein wenig höher, der MT etwas breiter.
Die Profiltiefe in beiden Fällen 14 mm, der Abrieb im XZL wegen der etwas
härteren Gummimischung etwas besser (2 mm auf 20.000 km im Vergleich zu 3 mm
auf 20.000 km beim MT). Preislich unterscheiden sich die beiden Reifen ganz erheblich,
der XZL ist ca. 50% teurer als der MT und oft nicht lieferbar! Trotz aller Bedenken
wurden letztlich die BFG MT in 255/85R16 gekauft. Sie haben sich bestens bewährt,
auch in sandigem Terrain und waren erstaunlicherweise unempfindlich gegen die langen
Dornen in Sahel und Savanne, denen man häufig nicht ausweichen kann. Genauso gut kamen sie
mit extrem steinigen und felsigen Passagen zurecht. Auf Asphalt ist das Verhalten als
durchaus akzeptabel zu bezeichnen (allerdings nicht so gut wie jenes des XZL), wobei das
Abrollgeräusch leiser als beim XZL ist und nicht unangenehm.
Bei unserer über fast 40.000 km langen Afrikatour 2007/2008 mit den BFG hatten wir keine einzige Reifenpanne
und einen beachtlich niedrigen Verschleiß (1 mm auf 10.000 km)! Steinige Strecken wie jene 500 km
lange Strecke von Moyale nach Isiolo (Kenya) setzen dem Gummi allerdings messbar zu.
Erfahrungen von unserer Tibet-Tour 2009
Diese Tour mit dem HZJ78 führte durch Zentralasien über fast 28.000 km zu den
Hochgebirgsregionen des Pamir und quer durch das Hochland Westtibets. Dabei hatte der Toyota Höhen
von bis zu 5.410 m zu erklimmen. Wie zu erwarten war, tat er sich dabei oft sehr schwer.
Dies äusserte sich in enormem Leistungsverlust wegen des stark reduzierten
Sauerstoffgehalts der dünnen Luft und den damit verbunden riesigen Russwolken
bei Vollgasfahrt bergauf. Natürlich hatte dies eine extreme Zunahme des Dieselverbrauchs zu Folge.
Von normalerweise weniger als 12 l /100 km stieg der Verbrauch bei Fahrten im Hochland Tibets auf knapp über
20 l /100 km. Die miserable Qualität des chinesischen Diesels trug ihren Teil dazu bei.
Auf dem langen Weg von Golmud über Lhasa, Ali und Mazar nach Yecheng sind viele
Pässe mit weit mehr als 5.000 m Höhe zu bewältigen. In der Regel konnten diese Pässe
nur im ersten Gang unter Vollgas bezwungen werden. Ein 5410 m hoher Pass in Aksai Chin nur dadurch, dass er
auf der breiten Piste in eigenen Serpentinen erklommen wurde. Ein anderes Mal konnte ein sehr steiler Pass auf dem Weg von Chüngya
nach Saga (nur 4870 m hoch und deswegen auf keiner Karte verzeichnet!) nur im 1. Gang Reduziergetriebe
bewältigt werden. Es ist klar, dass es diese Probleme mit einem Turbo nicht gegeben hätte.
So hatten die in Tibet üblichen LandCruiser mit Turbo-Benzinmotor auch keinerlei Schwierigkeiten
bei Passfahrten in extremer Höhe.
Erstaunlicherweise hielt das OME Fahrwerk problemlos durch, trotz der über lange Strecken im Pamir und
im tibetischen Hochland harten Pisten (auch Wellblech). Lediglich die inneren Original-Gummilager des vorderen
Stabilisators waren nach 60.000 km Afrika und Tibet durchgeschlagen und mußten ersetzt werden.
Ganz besondere, total verblüffende Erfahrungen machten wir mit den Bremsen. Bei Fahrten auf schwierigen Pisten
in abgelegenen Teilen des Pamirs hatten wir das Problem, dass die Bremswirkung erst nach mehrmaligem 'Pumpen'
einsetzte. Dies war uns unerklärlich, hatten wir doch vor Abreise die Bremsflüssigkeit
wechseln und die Bremsen kontrollieren lassen. Es war also unumgänglich, bei nächstbester Gelegenheit
der Sache in einer geeigneten Werkstatt nachgehen zu lassen. Eine solche Werkstatt fanden wir in Kashgar (China).
 4WD-Spezialwerkstatt in Kashgar (39°27.392'N - 75°59.014'E)
4WD-Spezialwerkstatt in Kashgar (39°27.392'N - 75°59.014'E)
Für den jungen Mechaniker war die Sache schnell klar: Nicht das Bremssystem war defekt,
Ursache des Problems war vielmehr übermäßiges Spiel in den vorderen Radlagern.
Nach perfekter, profihafter Arbeit war das Problem beseitigt und die Bremsen arbeiten seitdem absolut
einwandfrei. Spur und Sturz wurden zu einem späteren Zeitpunkt mit modernsten Geräten vermessen und neu eingestellt.
Preis für die Arbeiten in Kashgar: umgerechnet 45 EURO!
Motorölwechsel in Zentralasien ist ein Problem, da meist nur Öl in minderwertigen
Qualitäten verfügbar ist. Wir hatten deshalb von zu Hause 20 l vollsynthetisches
Motoröl der Marke BP Vanellus E8 Ultra 5W-30 mit den Spezifikationen
ACEA E4/E5, API CF mitgeführt, das wir bei einem Grosshändler zu einem guten
Preis von nur 5,20 EUR/Liter bekamen. Dieses Öl hat den Vorteil extrem langer Standzeiten.
Doch nach etwa 10.000 km unter härtesten Bedingungen in Tibet war auch dieses Öl am Ende.
Bei der Rückreise stellte sich anlässlich einer Inspektion in Aktöbe (Kasachstan) heraus,
dass ein Kreuzgelenk an der hinteren Kardanwelle schon leicht ausgeschlagen war, nach 160.000 km harter
Beanspruchung kein Wunder. Es wurde sogleich ausgetauscht. Kosten, inklusive Arbeit: keine 38 EURO!
Sehr zu meinem Erstaunen war der Verschleiss an den 255/85R16 BFG MT bei
dieser Reise mit fast 1.5 mm pro 10.000 km doch deutlich höher als bei
der Südafrikareise 2007/2008. Grund hierfür könnte der grosse
Anteil an sehr steinigen Wegen im Pamir und Tibet sein. Zu meiner sehr
grossen Überraschung gab es auch einen Reifendefekt, einen kleinen Schaden an der
äusseren Seitenwand des rechten Vorderreifens, der erst Stunden später (mitten in
der Nacht!) zum Plattfuss führte.
zum Seitenanfang
|